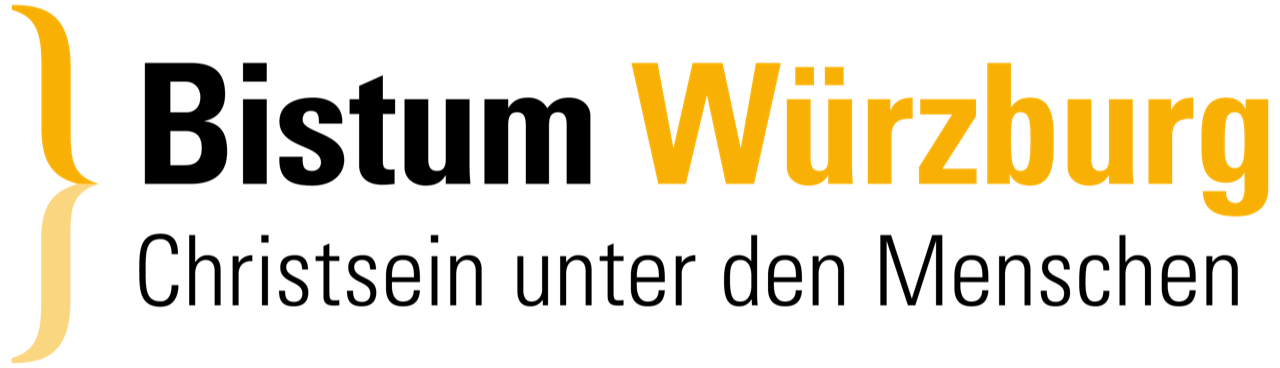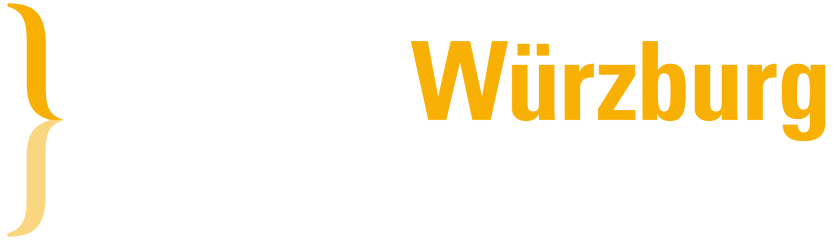Einen Kirchturm „wie er am ganzen Mainlauf nicht zu finden ist“ versprach Architekt Dominikus Böhm dem Bauherrn Pfarrer Alois Schneider. Tatsächlich erhebt sich der massige Chorturm 23 m über dem Altar und gießt durch seitliche Fenster regelrechte Lichtfluten über diesem aus. Beides – die Betonung der Altarstelle im Außenbau und die Lichtführung – sind Charakteristika des sogenannten Christozentrischen Bauens, das in den 1920er Jahren ein vorherrschendes Prinzip im katholischen Kirchenbau darstellte.
Dominikus Böhm, der wenige Jahre zuvor in Dettingen die erste moderne Kirche in Deutschland errichtet hatte, bekam den Auftrag, die zu klein gewordene Kapelle aus dem Jahr 1854 zu erweitern. An sie erinnern noch die Außenmauern von Eingangsfassade und Langhaus sowie einige Reste der seinerzeitigen Ausmalung, die vom Dachstuhl aus zu sehen sind. Der Dachreiter über der Eingangsfassade wurde erst 1952 abgebrochen. Statt des Chores der Kapelle errichtete Böhm eine eindrucksvolle Raumfolge: zunächst einen quadratischen Bau, der wie eine Vierung ohne Querhäuser wirkt, gefolgt von einem dunklen Durchgang, der schließlich in den lichtdurchfluteten Altarraum mündet. Der flachgedeckte einstige Kapellenraum von knapp 8 m Breite und nur 6 m Höhe verbreitert sich in der Vierung auf mehr als 12 m. Die Gewölbekonstruktion aus Beton beginnt direkt am Boden und überspannt den Raum ebenfalls in fast 12 m Höhe nach der Art eines sogenannten Klostergewölbes. Der fensterlose Durchgangsbereich zum Altarraum ist mit einer niedrigen Spitztonne gewölbt, die ebenfalls am Boden entspringt. Seitlich sind Sakristei (rechts) und einstige Taufkapelle (links, mit schmuckvollem Glasfenster) angebaut. Ziel der Raumfolge ist der Altarbereich, der als Untergeschoss des Turmes eine lichte Höhe von 9 m besitzt. Die einst 18 m lange Kapelle wurde auf 45 m erweitert; es entstand ein suggestiver „atmender“ Raum.
„Der alte schmale Raum weitet sich im neuen Teil nach Breite und Höhe, um im anschließenden Verbindungsraum sich wieder zu verengen auf die Breite und Höhe des alten Teils. Seine Erfüllung findet dieses Raumsehen im lichtdurchfluteten und wieder erweiterten Altarraum; also ein Atmen der Räume in ihrer Folge in Bezug auf Gestalt und Licht, also eine entschieden barocke Raumidee, wenn man natürlich nicht nach Einzelformen sucht.“ (Dominikus Böhm)
Neben dem Weiten und Verengen der aufeinanderfolgenden Raumkompartimente ist die Lichtführung bei Dominikus Böhm von entscheidender Bedeutung für die Raumwirkung. Die von den Kölner Werkschulen gestalteten Farbfenster lassen das Licht in unterschiedlichen dunklen Farbtönen einströmen. Einzig der Altarraum ist hell belichtet. An dieser Stelle steht der Altar mit dem Tabernakelgehäuse von Br. Adelmar Dölger aus Münsterschwarzach (beides 1957) und dem monumentalen Kruzifixus von Heinrich Wohlfahrt aus Steinheim (1960). Bereits 1941 hatte der Bildhauer eine Herz-Jesu-Büste und eine des Kirchenpatrons gefertigt. Die überlebensgroßen Statuen befinden sich heute im Depot des Heimatmuseums bzw. im Pfarrheim.
Ursprünglich war die ganze Kirche von Wandmalereien eines Kreuzwegzyklus’ von Alois Bergmann-Franken umzogen. Als Altarbild schuf der Maler eine wandfüllende Darstellung des sogenannten Gnadenstuhls, an der rechten Stirnwand der Vierung eine Darstellung des hl. Josef. Die Darstellung „Maria im Rosenhag“ an der linken Stirnwand schuf Karl Vollmer 1930.
Diese Gemälde, obwohl nahezu zeitgleich mit Reinhold Ewalds Dettinger Passion entstanden, atmeten einen eher flächigen graphischen Stil. Leider wurden sie im Rahmen der Renovierung 1957 entfernt und können so im Nebeneinander zweier Böhm-Kirchen in einer Kommune leider nicht mehr als Vergleich herangezogen werden.
Seit 1957 steht auch die lebensgroße Madonnenfigur an der rechten Vierungs-Stirnwand. Sie wurde um 1550 von Peter Dell aus Würzburg geschaffen und gelangte möglicherweise über die Mutterpfarrei Hörstein nach Großwelzheim.
Die Kirche wurde 2004–10 grundlegend renoviert und nach Plänen des diözesanen Kunstreferenten Jürgen Lenssen neu gestaltet. Seither ist der Zelebrationsaltar etwas näher zur Gemeinde gerückt und der Ambo zentral dahinter aufgestellt. Ein Radleuchter betont anstelle des von Dominikus Böhm 1929 geschaffenen Kronleuchters nun die Vierung. Eine Statue des Titelheiligen von Karlheinz Oswald – ein Abguss aus weißer Keramik der originalen Bronzeskulptur – befindet sich im hinteren Teil der Kirche und stellt Bonifatius als Wandermönch dar.
Michael Pfeifer