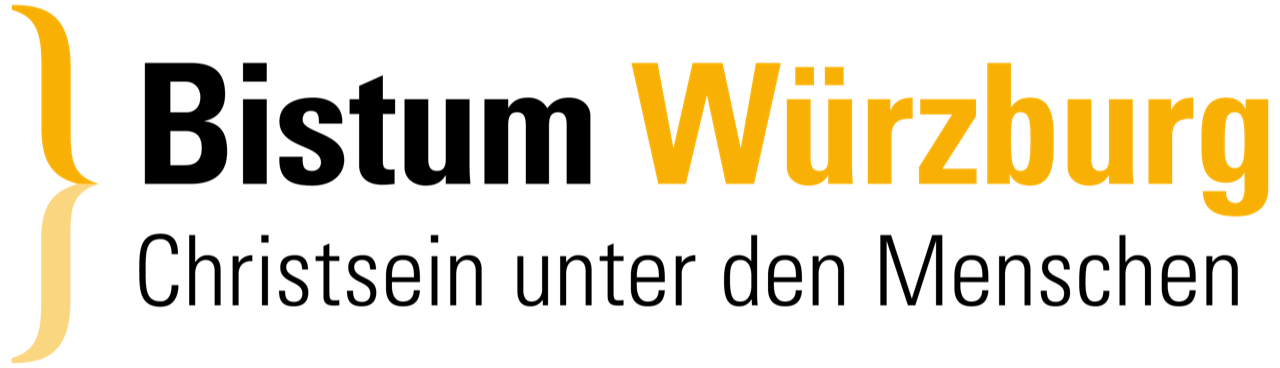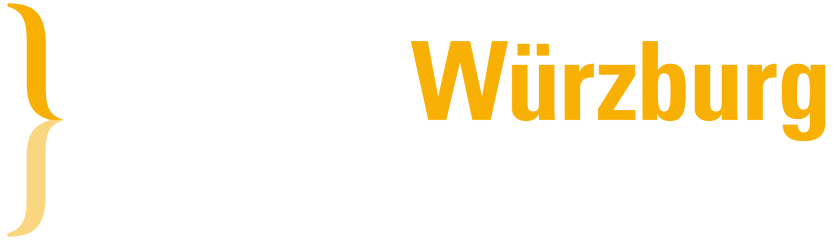Die Anfänge der Dettinger Kirche St. Hippolyt liegen im Dunkeln. Urkundlich ist eine Kirche für 1340 belegt. Dendrochronologische Untersuchungen legen eine Erbauungszeit zwischen 1150 und 1270 nahe. Der Vergleich mit anderen Hippolyt-Patronaten lässt vermuten, dass die Kirchengründung in Dettingen bereits ins 9. oder 10. Jahrhundert zu datieren ist und im Zusammenhang mit der Reliquientranslation durch Abt Fuldrad Mitte des 8. Jhs. nach Andolsweiler im Elsass, dem späteren Saint Hippolyte zu sehen ist. Die Legende, Karl der Große (742–814) habe zum Dank für die Rettung einer seiner Gefolgsleute die Dettinger Kirche gestiftet, fasst diese frühe Datierung in eine Erzählung. Sie stand auch Pate bei der Wahl des Ortsnamens „Karlstein“ für die im Zuge der Gebietsreform 1975 fusionierten Gemeinden Dettingen und Großwelzheim.
Der heutige Bau stammt im Wesentlichen aus dem 15. Jahrhundert und ist ein hervorragendes Werk der Spätgotik. Durch Inschriften lassen sich der Altar auf 1421, die Fertigstellung des Chores auf 1447 datieren. In den Fensterlaibungen deuten Reste von Heiligendarstellungen auf die einstige Ausmalung des gesamten Kirchenraumes hin. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche auf der Nordseite erweitert. Steinmetzzeichen belegen die Beteiligung von Handwerkern der Straßburger, Mainzer und Frankfurter Bauhütten. Das erklärt die ausgesprochen qualitätvollen Arbeiten des Gewölbes, des Sakramentshauses und des Zelebrantensitzes mit dem „Dettinger Kreuz“. Die Schlusssteine des Gewölbes zeigen im Seitenschiff Wappen und zentral im Chor das Lamm Gottes. Das Sakramentshaus umgeben eine Statue des Schmerzensmanns und Engelsfiguren, die die Arma Christi tragen. Der Zelebrantensitz rechts im Chor ist mit reichem Maßwerk geschmückt. Sein Gewölbe bildet im Mittelfeld eine Raute, die ein T-förmiges Kreuz trägt. Daran ist eine mit Stricken gebundene, mit knielangem Gewand und Kopfbedeckung bekleidete Gestalt zu sehen. Sie wird gerne als Kümmernis bzw. Wilgefortis gedeutet und stammt mithin aus einer Zeit, in der man die romanischen Darstellungen des Gekreuzigten im königlichen Gewand nicht mehr verstand.
Die Dettinger Hippolytkirche war über Jahrhunderte ein viel besuchtes Wallfahrtsziel. Die bei Grabungen in der Sakristei gefundenen 54 Münzen decken einen Zeitraum von 1350–1655 und einen großen Bereich des deutschen Sprachraums ab. Noch Ende des 18. Jahrhunderts wurden Ablassbriefe für die Wallfahrer ausgestellt.
Damals wurde der Zugang zur Kirche von der Süd- an die Westseite verlegt (1762) und die Fenster im Langhaus vergrößert (1776). Weitere Renovierungen fanden 1948, 1950, 1977 und 2009 statt. Seither dominiert den Raum ein farbintensives Tryptichon von Markus Fräger auf dem Altar, der eigentlich seit der Purifizierung 1950 – also lange vor dem 2. Vatikanischen Konzil – bereits versus populum benutzt worden war. An der Retabelrückseite befindet sich seit 2017 ein Hippolyt-Reliquiar. Es stammt aus den Hanauer Bernwards-Werkstätten.
Zwei Epitaphien für kaiserliche Posthalter schmücken ferner die Kirche: Rechts im Chor eine ovale Schriftplatte umrahmt von einer von Engeln gehaltenen Stoffdraperie für Andreas Wissner (1714) und eine stark verwitterte Grabplatte von 1716, die inzwischen im Eingangsbereich präsentiert wird. Zwei weitere Grabplatten finden sich im Außenbereich. Rätselhaft bleiben die eingemeißelten Zeichen auf einem großen Sandsteinfindling, der bei archäologischen Grabungen 1969 entdeckt wurde. Seinerzeit wurden auch zwei Gräber am Übergang zum Chor gefunden. Im Bodenbelag fanden sich unabhängig davon die zwei genannten Grabplatten sowie zwei Altarplatten, die auf einstige Seitenaltäre schließen lassen.
Über dem Altar des linken Seitenschiffs hängt ein Gemälde Maria Immaculata des Aschaffenburger Malers Johann Konrad Bechtold (1698–1786). Neben einer Büste des Kirchenpatrons, das den Heiligen mit gesprengten Ketten zeigt, schmückt die Kirche ein weiteres Barockgemälde, das die Legende des von Pferden zu Tode geschleiften Soldatenheiligen zeigt. Einen Überblick über die verschiedenen Hippolyt-Legenden finden Sie hier.
Michael Pfeifer
Die Kirche ist nur zu Gottesdienst und Veranstaltung geöffnet. Besuche und Führungsanfragen koordiniert der Geschichtsverein Karlstein.