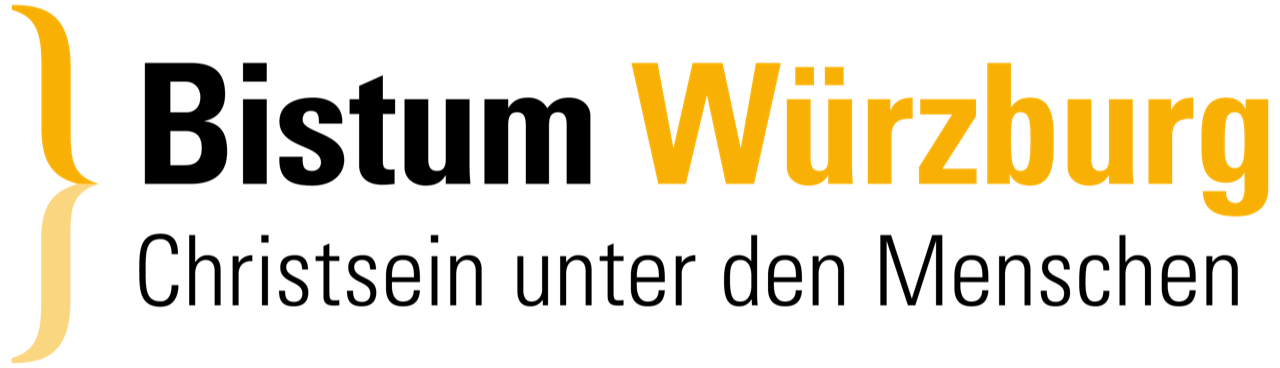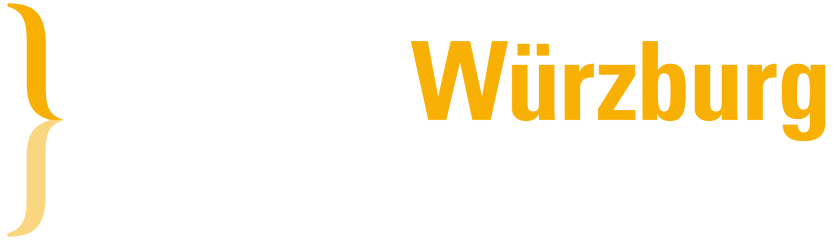Koordinierung des Pastoralen Raumes
Alfred-Delp-Str. 4; 63755 Alzenau
pr.alzenau@bistum-wuerzburg.de
- Gemeinden
Dettingen – ein alter Wallfahrtsort
Über die Anfänge kirchlichen Lebens und die erste Kirche in Dettingen gibt es keine gesicherten Nachrichten. Urkundlich greifbar wird eine Kirche in Dettingen 1340. Doch archäologische Forschungen brachten Grundmauern aus weit älterer Zeit zu Tage.

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Dettingen am Main wurde am 1. Juli 1923 geweiht. Hugo Schnell bezeichnete sie zu Recht als die erste moderne Kirche in Deutschland. Besondere Beachtung verdienen die Fresken des Malers Reinhold Ewald.

Die Anfänge der Dettinger Kirche St. Hippolyt liegen im Dunkeln. Urkundlich ist eine Kirche für 1340 belegt. Dendrochronologische Untersuchungen legen eine Erbauungszeit zwischen 1150 und 1270 nahe. Der Vergleich mit anderen Hippolyt-Patronaten lässt vermuten, dass die Kirchengründung in Dettingen bereits ins 9. oder 10. Jahrhundert zu datieren ist und im Zusammenhang mit der Reliquientranslation durch Abt Fuldrad Mitte des 8. Jhs. nach Andolsweiler im Elsass, dem späteren Saint Hippolyte zu sehen ist. Die Legende, Karl der Große (742–814) habe zum Dank für die Rettung einer seiner Gefolgsleute die Dettinger Kirche gestiftet, fasst diese frühe Datierung in eine Erzählung. Sie stand auch Pate bei der Wahl des Ortsnamens „Karlstein“ für die im Zuge der Gebietsreform 1975 fusionierten Gemeinden Dettingen und Großwelzheim.
Der heutige Bau stammt im Wesentlichen aus dem 15. Jahrhundert und ist ein hervorragendes Werk der Spätgotik. Durch Inschriften lassen sich der Altar auf 1421, die Fertigstellung des Chores auf 1447 datieren. In den Fensterlaibungen deuten Reste von Heiligendarstellungen auf die einstige Ausmalung des gesamten Kirchenraumes hin. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche auf der Nordseite erweitert. Steinmetzzeichen belegen die Beteiligung von Handwerkern der Straßburger, Mainzer und Frankfurter Bauhütten. Das erklärt die ausgesprochen qualitätvollen Arbeiten des Gewölbes, des Sakramentshauses und des Zelebrantensitzes mit dem „Dettinger Kreuz“. Die Schlusssteine des Gewölbes zeigen im Seitenschiff Wappen und zentral im Chor das Lamm Gottes. Das Sakramentshaus umgeben eine Statue des Schmerzensmanns und Engelsfiguren, die die Arma Christi tragen. Der Zelebrantensitz rechts im Chor ist mit reichem Maßwerk geschmückt. Sein Gewölbe bildet im Mittelfeld eine Raute, die ein T-förmiges Kreuz trägt. Daran ist eine mit Stricken gebundene, mit knielangem Gewand und Kopfbedeckung bekleidete Gestalt zu sehen. Sie wird gerne als Kümmernis bzw. Wilgefortis gedeutet und stammt mithin aus einer Zeit, in der man die romanischen Darstellungen des Gekreuzigten im königlichen Gewand nicht mehr verstand.
Die Dettinger Hippolytkirche war über Jahrhunderte ein viel besuchtes Wallfahrtsziel. Die bei Grabungen in der Sakristei gefundenen 54 Münzen decken einen Zeitraum von 1350–1655 und einen großen Bereich des deutschen Sprachraums ab. Noch Ende des 18. Jahrhunderts wurden Ablassbriefe für die Wallfahrer ausgestellt.
Damals wurde der Zugang zur Kirche von der Süd- an die Westseite verlegt (1762) und die Fenster im Langhaus vergrößert (1776). Weitere Renovierungen fanden 1948, 1950, 1977 und 2009 statt. Seither dominiert den Raum ein farbintensives Tryptichon von Markus Fräger auf dem Altar, der eigentlich seit der Purifizierung 1950 – also lange vor dem 2. Vatikanischen Konzil – bereits versus populum benutzt worden war. An der Retabelrückseite befindet sich seit 2017 ein Hippolyt-Reliquiar. Es stammt aus den Hanauer Bernwards-Werkstätten.
Zwei Epitaphien für kaiserliche Posthalter schmücken ferner die Kirche: Rechts im Chor eine ovale Schriftplatte umrahmt von einer von Engeln gehaltenen Stoffdraperie für Andreas Wissner (1714) und eine stark verwitterte Grabplatte von 1716, die inzwischen im Eingangsbereich präsentiert wird. Zwei weitere Grabplatten finden sich im Außenbereich. Rätselhaft bleiben die eingemeißelten Zeichen auf einem großen Sandsteinfindling, der bei archäologischen Grabungen 1969 entdeckt wurde. Seinerzeit wurden auch zwei Gräber am Übergang zum Chor gefunden. Im Bodenbelag fanden sich unabhängig davon die zwei genannten Grabplatten sowie zwei Altarplatten, die auf einstige Seitenaltäre schließen lassen.
Über dem Altar des linken Seitenschiffs hängt ein Gemälde Maria Immaculata des Aschaffenburger Malers Johann Konrad Bechtold (1698–1786). Neben einer Büste des Kirchenpatrons, das den Heiligen mit gesprengten Ketten zeigt, schmückt die Kirche ein weiteres Barockgemälde, das die Legende des von Pferden zu Tode geschleiften Soldatenheiligen zeigt. Einen Überblick über die verschiedenen Hippolyt-Legenden finden Sie hier.
Michael Pfeifer
Die Kirche ist nur zu Gottesdienst und Veranstaltung geöffnet. Besuche und Führungsanfragen koordiniert der Geschichtsverein Karlstein.

Schulstraße 21
63791 Karlstein
Hausmeisterin Susanne Reubold
E-Mail: s-reubold60@gmx.de
Pfarrheim-Belegung
Die Räume im Pfarrheim St. Peter und Paul können von den verschiedenen Gruppen der Pfarrei genutzt werden. Auch Privatpersonen können verschiedene Räume gegen ein Entgelt für Familienfeiern o. ä. mieten.
Die Buchungen übernimmt unsere Hausmeisterin Frau Susanne Reubold. Anfragen sind über die E-Mail: s-reubold60@gmx.de möglich.
Im Jahre 772 wird Walinesheim, das spätere Großwelzheim, in einer Schenkungsurkunde an das Reichskloster Lorsch erstmals erwähnt. Kirchlich gehörte Großwelzheim abwechselnd zu den Pfarreien Kahl und Hörstein. Eine eigene Pfarrkirche erhielt der Ort erst 1927. Zuvor gab es eine Kapelle, die, wie alle folgenden, dem hl. Bonifatius geweiht war. Schriftlich bezeugt ist sie erst 1685, bereits 1592 findet sich aber auf einer Landkarte des Freigerichts eine Kapelle mit umgebendem Friedhof in der Ortsmitte von Welsheim. Ihren Standort an der Hauptstraße markiert heute das einstige Turmkreuz und ein Gedenktafel. Auch die Straßenbezeichnung Kapellengasse erinnert daran.
1775 wurde die Kapelle erweitert. Damals gehörte Großwelzheim zur Pfarrei Kahl. Hieran erinnert auch heute noch der Kahler Kirchweg. Dieser wird bereits in einer Urkunde des Jahres 1386 als von Welzheim nach Kahl führend genannt. Später wurden nicht nur Großwelzheim, sondern auch Kahl Filialorte der Pfarrei Hörstein.
Die einstige Gottesdienstordnung ist wegen der Rechte der verschiedenen Pfarreien etwas verworren. Nur am Fest des Kirchenpatrons St. Bonifatius hatten die Großwelzheimer Anspruch auf eine Messe. Sonst mussten sie den Gottesdienst in Kahl oder Hörstein besuchen.
Als Kahl im Jahr 1769 Kaplanei wurde und eine Kirche baute, wollten Kahl und Großwelzheim sich von Hörstein trennen. Dagegen wehrte sich der damalige Hörsteiner Pfarrer Carolus Ignatius Arnold jedoch mit Erfolg. Großwelzheim konnte zu dieser Zeit für den Sonntagsgottesdienst einen Geistlichen aus dem Kloster in Seligenstadt gewinnen. Dagegen verwahrte sich der Hörsteiner Pfarrer ebenfalls.
1853/54 wird ein neues Gotteshaus von bescheidener Größe (8×18 m) am Platz der heutigen Kirche errichtet. Die Trennung von der Pfarrei Hörstein bedeutete das noch nicht. Doch fortan feierte man jeden Sonntag und zusätzlich an zwei Wochentagen Gottesdienst in der neuen Kirche. Erst 1907, nachdem Kahl Pfarrort geworden war, erhielt Großwelzheim eine eigene Expositurkaplanei. Im gleichen Jahr bauten die Großwelzheimer für den Geistlichen ein Pfarrhaus am Wiesenweg.
Der erste selbständige Großwelzheimer Seelsorger war Kuratus Albert Susann. Er war in der Gemeinde von 1907 bis 1914 tätig, dann wurde er Militärseelsorger. Kuratus Alois Grünewald war sein Nachfolger. Als an Weihnachten 1922 Großwelzheim zur selbständigen Pfarrei erhoben wurde, wurde Alois Grünewald mit Wirkung zum 1. April 1923 erster Pfarrer von Großwelzheim. Die Bevölkerungszahl lag inzwischen bei etwa 1400 Einwohnern, so konnte die Erweiterung des alten Kirchleins nicht mehr länger hinausgeschoben werden. Von der bischöflichen Behörde erhielt Grünewald den Auftrag, die Kirche zu erweitern. Am 2. Mai 1926 wurde der Grundstein gelegt und bereits ein Jahr später am 22. Mai 1927 erfolgte die Weihe durch Bischof Matthias Ehrenfried.
Die gesamten Maurerarbeiten führte der Großwelzheimer Bauunternehmer Wilhelm Hornung aus. Die Kosten beliefen sich auf 80.000 Mark. Die Gemeinde gab 7.000 Mark dazu, das bischöfliche Ordinariat gewährte einen Zuschuss von 15.000 Mark und ein Darlehen von 32.000 Mark. Die Pfarreimitglieder gaben hohe Spenden und leisteten für etwa 20.000 Mark Hand- und Spanndienste.
Nur ein Jahr nach der Kirchweihe verließ Pfarrer Grünewald die Pfarrei und übergab sie seinem Nachfolger Alfons Schneider, der bis 1948 als Pfarrer von Großwelzheim wirkte. Er bemühte sich besonders um die Vollendung der Ausstattung des Gotteshauses. Am 14. März 1948 wurde Pfarrer Burkhard auf die Pfarrei übertragen. 1949 gelang es ihm, zwei neue Glocken zu beschaffen. 1957 stieß er eine grundlegende Renovierung und Umgestaltung der Kirche an, wobei auch die Wandbilder von Bergmann-Franken und Vollmer verschwanden.
Im Jahre 1963 kam Pfarrer Johannes Zimmermann nach Großwelzheim. Unter seiner Ägide wurde der Altarraum 1967/68 entsprechend der erneuerten Liturgie umgestaltet und die Kirche in den Jahren 1971/72 abermals renoviert und modernisiert. 1998 ging Pfarrer Zimmermann in den Ruhestand, blieb aber zunächst in Großwelzheim wohnen.
Der Pfarrer der Nachbargemeinde Dettingen, Franz Kraft, übernahm ab diesem Zeitpunkt die Großwelzheimer Pfarrgemeinde. Als mitarbeitender Priester unterstützte Pfarrer Zimmermann seinen Amtsbruder noch einige Jahre.
Am 27. November 1988 wurde das neue Pfarrheim offiziell seiner Bestimmung übergeben. Neben der Kirche ist es ein wichtiger Mittelpunkt des aktiven Lebens der Pfarrgemeinde geworden, eine Begegnungsstätte mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Bereits 1960 war ein erster Anlauf zum Neubau eines Pfarrheims unternommen worden. Die Anregung dazu kam vom damaligen Ortsgeistlichen Pfarrer Burkhard Ruf. Ein zweiter Anlauf erfolgte im Jahr 1978 auf Anregung der katholischen Vereine und Gruppen. Beide Versuche scheiterten wegen finanzieller Probleme. Erst der dritte Anlauf führte zum Erfolg. Die Planungsgemeinschaft Fey und Focht, Aschaffenburg, wurde im Juni 1984 mit der Realisierung des Bauvorhabens beauftragt.
Für viele überraschend verließen Pfarrer Kraft und Pfarrer Zimmermann die Pfarreiengemeinschaft Karlstein im Lauf des Jahres 2008. Kraft wechselte in die Pfarrei Erlenbach am Main, Zimmermann kehrte nach Würzburg zurück, wo er einst sein Abitur abgelegt und studiert hatte.
Während der Vakanz leitete für kurze Zeit Uwe Hartmann aus Kahl als Administrator die Pfarrei, dann in gleicher Funktion Pater Peter Kotwica bis zur Einführung von Pfarrer Dr. Krzysztof Sierpien im September 2010. Den Vorsitz der Kirchenverwaltung hatte Diakon Michael Balbach übernommen. In den Anfangsjahren standen Pfarrer Dr. Sierpien zunächst Pfarrvikar George Kalathurparampil, später Dr. Aloysius Cheta Chikezie als mitarbeitender Priester hilfreich zur Seite. Eine wertvolle Stütze für ihn war auch Diakon Michael Balbach, der sich 22 Jahre in der Pfarrei engagierte.
Inzwischen ist die Pfarrei Großwelzheim in den pastoralen Raum Alzenau, Kahl, Karlstein eingebunden.
Helmut Nimbler und Gerhard Reisert
(bearbeitet von Michael Pfeifer)
Einen Kirchturm „wie er am ganzen Mainlauf nicht zu finden ist“ versprach Architekt Dominikus Böhm dem Bauherrn Pfarrer Alois Schneider. Tatsächlich erhebt sich der massige Chorturm 23 m über dem Altar und gießt durch seitliche Fenster regelrechte Lichtfluten über diesem aus. Beides – die Betonung der Altarstelle im Außenbau und die Lichtführung – sind Charakteristika des sogenannten Christozentrischen Bauens, das in den 1920er Jahren ein vorherrschendes Prinzip im katholischen Kirchenbau darstellte.
Dominikus Böhm, der wenige Jahre zuvor in Dettingen die erste moderne Kirche in Deutschland errichtet hatte, bekam den Auftrag, die zu klein gewordene Kapelle aus dem Jahr 1854 zu erweitern. An sie erinnern noch die Außenmauern von Eingangsfassade und Langhaus sowie einige Reste der seinerzeitigen Ausmalung, die vom Dachstuhl aus zu sehen sind. Der Dachreiter über der Eingangsfassade wurde erst 1952 abgebrochen. Statt des Chores der Kapelle errichtete Böhm eine eindrucksvolle Raumfolge: zunächst einen quadratischen Bau, der wie eine Vierung ohne Querhäuser wirkt, gefolgt von einem dunklen Durchgang, der schließlich in den lichtdurchfluteten Altarraum mündet. Der flachgedeckte einstige Kapellenraum von knapp 8 m Breite und nur 6 m Höhe verbreitert sich in der Vierung auf mehr als 12 m. Die Gewölbekonstruktion aus Beton beginnt direkt am Boden und überspannt den Raum ebenfalls in fast 12 m Höhe nach der Art eines sogenannten Klostergewölbes. Der fensterlose Durchgangsbereich zum Altarraum ist mit einer niedrigen Spitztonne gewölbt, die ebenfalls am Boden entspringt. Seitlich sind Sakristei (rechts) und einstige Taufkapelle (links, mit schmuckvollem Glasfenster) angebaut. Ziel der Raumfolge ist der Altarbereich, der als Untergeschoss des Turmes eine lichte Höhe von 9 m besitzt. Die einst 18 m lange Kapelle wurde auf 45 m erweitert; es entstand ein suggestiver „atmender“ Raum.
„Der alte schmale Raum weitet sich im neuen Teil nach Breite und Höhe, um im anschließenden Verbindungsraum sich wieder zu verengen auf die Breite und Höhe des alten Teils. Seine Erfüllung findet dieses Raumsehen im lichtdurchfluteten und wieder erweiterten Altarraum; also ein Atmen der Räume in ihrer Folge in Bezug auf Gestalt und Licht, also eine entschieden barocke Raumidee, wenn man natürlich nicht nach Einzelformen sucht.“ (Dominikus Böhm)
Neben dem Weiten und Verengen der aufeinanderfolgenden Raumkompartimente ist die Lichtführung bei Dominikus Böhm von entscheidender Bedeutung für die Raumwirkung. Die von den Kölner Werkschulen gestalteten Farbfenster lassen das Licht in unterschiedlichen dunklen Farbtönen einströmen. Einzig der Altarraum ist hell belichtet. An dieser Stelle steht der Altar mit dem Tabernakelgehäuse von Br. Adelmar Dölger aus Münsterschwarzach (beides 1957) und dem monumentalen Kruzifixus von Heinrich Wohlfahrt aus Steinheim (1960). Bereits 1941 hatte der Bildhauer eine Herz-Jesu-Büste und eine des Kirchenpatrons gefertigt. Die überlebensgroßen Statuen befinden sich heute im Depot des Heimatmuseums bzw. im Pfarrheim.
Ursprünglich war die ganze Kirche von Wandmalereien eines Kreuzwegzyklus’ von Alois Bergmann-Franken umzogen. Als Altarbild schuf der Maler eine wandfüllende Darstellung des sogenannten Gnadenstuhls, an der rechten Stirnwand der Vierung eine Darstellung des hl. Josef. Die Darstellung „Maria im Rosenhag“ an der linken Stirnwand schuf Karl Vollmer 1930.
Diese Gemälde, obwohl nahezu zeitgleich mit Reinhold Ewalds Dettinger Passion entstanden, atmeten einen eher flächigen graphischen Stil. Leider wurden sie im Rahmen der Renovierung 1957 entfernt und können so im Nebeneinander zweier Böhm-Kirchen in einer Kommune leider nicht mehr als Vergleich herangezogen werden.
Seit 1957 steht auch die lebensgroße Madonnenfigur an der rechten Vierungs-Stirnwand. Sie wurde um 1550 von Peter Dell aus Würzburg geschaffen und gelangte möglicherweise über die Mutterpfarrei Hörstein nach Großwelzheim.
Die Kirche wurde 2004–10 grundlegend renoviert und nach Plänen des diözesanen Kunstreferenten Jürgen Lenssen neu gestaltet. Seither ist der Zelebrationsaltar etwas näher zur Gemeinde gerückt und der Ambo zentral dahinter aufgestellt. Ein Radleuchter betont anstelle des von Dominikus Böhm 1929 geschaffenen Kronleuchters nun die Vierung. Eine Statue des Titelheiligen von Karlheinz Oswald – ein Abguss aus weißer Keramik der originalen Bronzeskulptur – befindet sich im hinteren Teil der Kirche und stellt Bonifatius als Wandermönch dar.
Michael Pfeifer

Klostergasse 2
63791 Karlstein
Hausverwaltung:
Familie Reinfurth (06188 7628)
email: juergen.reinfurth@freenet.de
Pfarrheim-Belegung
Die Räume im Pfarrheim St. Bonifatius können von den verschiedenen Gruppen der Pfarrei genutzt werden. Auch Privatpersonen können verschiedene Räume gegen ein Entgelt für Familienfeiern o. ä. mieten.
Mietkosten:
- für Bürger Karlsteins 100 €
- für Auswärtige 150 €
In den Monaten Oktober bis einschließlich April berechnen wir zusätzlich eine Mietpauschale von 20 €.
Nähere Einzelheiten können Sie bei der Familie Reinfurth unter Tel. 06188 7628 erfragen.